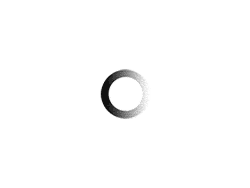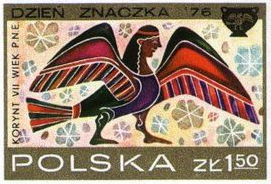Ansätze einer Post sind auf polnischem Gebiet etwa ab dem Moment der Entstehung einer zentralisierten prinzlichen und dann königlichen Verwaltung. Bereits unter den ersten polnischen Herrschern, der Piasten-Dynastie, entsteht ein informales Transportnetzwerk.
Der überwiegende Teil der Briefe, sofern man damals von Briefen sprechen kann, wird angelegentlich transportiert: ein reisender Adeliger nimmt eine Botschaft mit, ein Kaufman einen von städtischen Schreiben geschriebenen Brief. Wie überall in Europa ist diese Art der Post sehr langsam und äußerst unzuverlässig: der Reisende kann getötet werden, seine Reiseroute ändern oder die Nachricht kann verloren gehen, vor allem bei einer mündlichen Übertragung.

Die Herrscher setzen daher auf eigene Kuriere, genannt „Komornik“. In der Regel sind es Söhne des Adels, welche auf diese Weise mit vertraulichen Botschaften zu anderen Prinzen oder Königen unterwegs sind.
Ein stabiles, regelmässiges System existiert nicht. Mit jeder Botschaft wird ein neuer Bote geschickt, der sich auf diese gefährliche Reise macht. Selbst in Friedenszeiten ist das Gebiet des mittelalterlichen Polens nie wirklich sicher. In den immer wieder und da aufflammenden kleinen und größeren Kriegen dürfte so manche Botschaft verloren gehen.
Trotzdem funktionierte diese Post erstaunlich gut, vor allem dank der „Podwody“, einem Privileg des Boten, Pferde und Fuhrwagen der lokalen Bevölkerung zu benutzen, wann und wie es ihm immer beliebte. Diese Regelung führte als erster Bolesław Chrobry (geboren 967, ab 1025 der erste gekrönte König Polens 1025, gestorben 17. Juli 1025), um die Geschwindigkeit der staatlichen Informationsverteilung zu beschleunigen.

Zuerst galt das Privileg ausschließlich für Städte und befestigte Orte, doch spätere Piastenherrscher erweiterten in Kürze dieses Recht auf kleinere Orte und Dörfer, jedoch leidglich in königlichen und einigen kirchlichen Domänen. Ortschaften, die Adeligen oder restlichen kirchlichen Eigentümern gehörten, blieben von „Podwodów“ verschont.
Der Bote suchte in jeder gewünschten Ortschaft erst einmal die lokale Obrigkeit auf, in der Regel Wójt oder Bürgermeister. Ihm legte er die Vollmacht, die ihm „Podwody“ erlaubte und bezahlte sofort den fälligen Betrag, falls notwendig. Falls, denn in der Regel waren die königlichen Ortschaften dazu verpflichtet, den Dienst kostenfrei zu leisten, weshalb sie gern und häufig beim König um Befreiung von der kostenlosen Dienstleistung vorsprachen.
Es ist etwas verwunderlich, wieso nicht selten reiche Städte um Befreiung von dem recht einfachen Dienst baten. Doch in Wirklichkeit konnten die Kosten erstaunlich hoch werden. Auf diese Weise reisten eben nicht nur Boten, sondern auch Bedienstete des Königs und manchmal auch er selbst mit seiner gesamten Equipage. Da die Städte darüber hinaus auch noch verpflichtet waren, für den Unterhalt des Königs und seines gesamten Hofes zu sorgen, versteht man schnell um welche hohe Beträge es sich handelt konnte.
Zu welchen Exzessen dieses Privileg führte und zu welchen Klagen blieb sogar den Ohren des polnischen Chronisten Kadłubek nicht verwehrt. In seiner Chronik schreibt er von der missbräulichen Nutzung durch den Adel, der routinemäßig seinen Bediensteten auftrug, im Rahmen der „Podwody“ auf die Pferde der Bauern zurückzugreifen. Nicht selten waren Fälle, wo einem Bauer von der Feldarbeit das Pferd einkassiert wurde und für einen zu Tode gerittenen Gaul gab es natürlich überhaupt keine Entschädigung.

Vor allem die großen Städte wie Kraków, Lwów, Sandomierz, Przemyśl, Pilsen, Wieliczka etc. litten unter den ruinösen Kosten des Privleges. Erst König Władysław Jagiełło sorgt hier für etwas Frieden: für seinen Krieg mit dem Deutschen Orden benötigt er Geld und, um die Städte und die Bürger freundlich zu stimmen, befreit er im 15. Jahrhundert die eine oder andere Stadt von der Pflicht, Podwody kostenfrei zu leisten.
Doch erst im Sejm 1564 unter dem König Zygmunt August kommt es zu einer Regelung für alle. Es wird beschlossen, Podwody nicht mehr kostenfrei zu leisten, sondern es wird eine spezielle Steuer für alle königlichen Städte und Dörfer eingeführt um diesen zu begleichen.
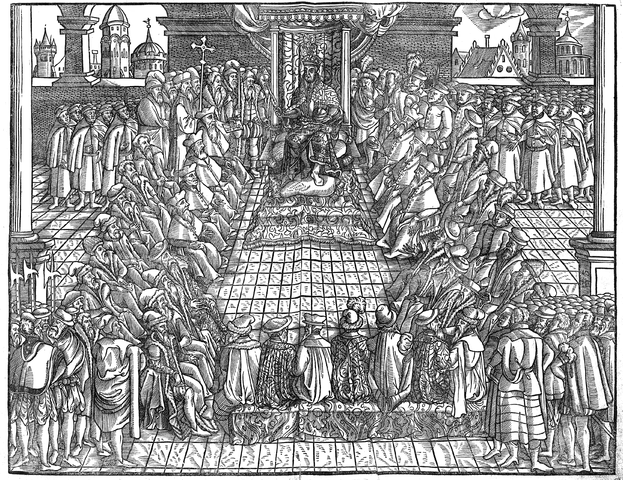
Die Berechnung der Summe war etwas kompliziert. Für die Städte wurde eine neue Steuer „szosa“ erhoben, die 16% des geschätzten Wertes aller Immobilien und aller Betriebe innerhalb der Stadtmauer erfasste. Für die Podwody-Steuer wurde ¾ dieser Summe abgespalten und einmal pro Jahr an die königliche Verwaltung abgeführt.
Die Dörfer hingegen hatten 6 Groszy pro Flur sowie zusätzliche Steuern („czopowe“) auf Alkohol zu zahlen. Das Geld wurde vom Ältesten des Dorfes eingezogen und anschließend an den königlichen Schatz abgeführt.
Zusätzlich wurde jeder Eigentümer eines Flures verpflichtet, mindestens zwei Pferde zu halten, während in den Städten Magistrat Personen benennen musste, die diese Aufgabe hatten. Ab jetzt wurde es für den Komornik (Bote) verpflichtend, nur und ausschließlich beim Bürgermeister oder dem Dorfältesten die Pferde zu tauschen, um Missbrauch zu vermeiden.
Festgelegt wurden auch die Gebühren, die zu zahlen waren: Nutzung eines Pferdes ohne Wagen: 1,5 Groszy pro Meile bzw. Pferd mit Wagen 2 Groszy pro Meile.
Verboten wurde nun dem Boten, festgelegte Wechselplätze zu umgehen oder gar Pferde der Reisenden zu requirieren, und das unter der Strafe von zwei Wochen Kerkerhaft und Verbot, sich weiterhin als Bote zu betätigen.
Alle erteilten Privilegien, die von kostenfreier Leistung befreiten, wurden gleichzeitig aufgehoben.